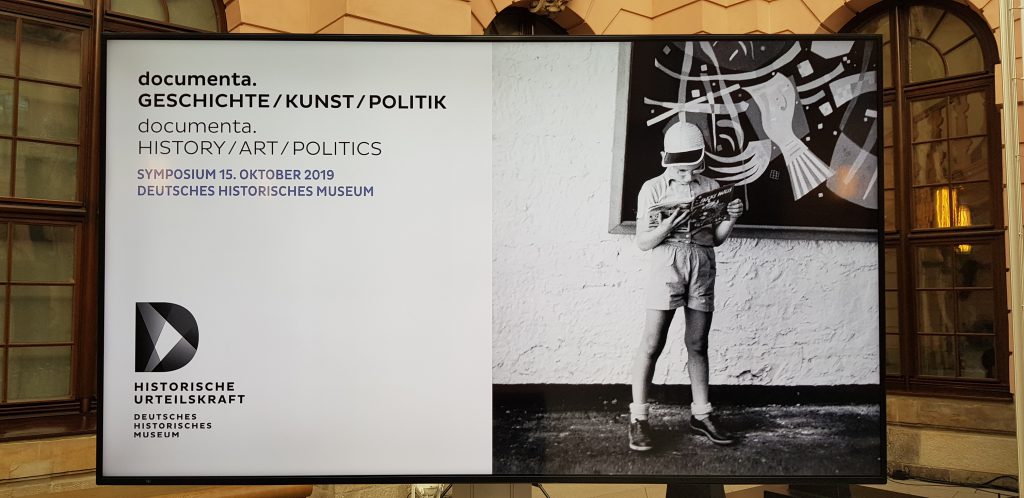„Kapitän“, „Intervenierer“, „Geistespersönlichkeit“. Die Lobesvokabeln wollten kein Ende nehmen, mit denen Mitte August eine illustre Runde von Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) bis Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) den Soziologen Heinz Bude in Kassels Museum Fridericianum bedachten.
Insider wussten es schon länger, aber erst vergangene Woche gaben die documenta und die Universität Kassel bekannt, dass der 1954 geborene Wissenschaftler, dort seit 2000 Professor für Makrosoziologie, „Gründungsdirektor“ des neuen documenta-Instituts werden soll.
Spätestens mit seinem Essay zur „Generation Berlin“ ist Bude zu einem der markantesten Intellektuellen Deutschlands avanciert. Insofern kann sich die Universität glücklich schätzen, solch ein Aushängeschild für die neue Institution gewonnen zu haben.
Als soeben emeritierter Professor hat Bude die nötige Zeit, kennt das Machtsystem von Politik und Wissenschaft in der Stadt. Wenn die Berufung nicht den Beigeschmack hatte, dass – ähnlich wie bei Berlins Humboldt-Forum – einmal mehr ein älterer weißer Mann die Führung einer innovativ gedachten, neuen Institution übernehmen soll.
Für einen „Fachfremden“ (den man in den letzten Jahre freilich überraschend häufig in Kunstmuseen treffen konnte) war Bude bei seiner Vorstellung um schwungvolle Analysen und Visionen allerdings nicht verlegen.
Die „einmalige Chance“ des Instituts mit seinen drei, in Kürze zu besetzenden Professuren sieht er darin, „dass es die documenta als ein Modell der Ausstellung von Gegenwartskunst versteht und damit das weltgesellschaftliche Phänomen der Biennalisierung des Kunstfelds in den Griff bekommt“.
Einen weiteren Lichtblick für die, im Vorfeld umstrittene Struktur des Instituts, eröffnete Ministerin Dorn. Neben den je 6 Millionen Euro, mit der die Stadt Kassel und das Land Hessen und den zwölf Millionen, mit denen der Bund die Errichtung des Institut finanzieren, stellt Dorn zusätzlich 200000 Euro für „künstlerische Forschung“ zur Verfügung.
Für diesen Ansatz hatte sich die scheidende documenta-Professorin Nora Sternfeld in einer Denkschrift unter dem Titel „Eine Frage der Haltung“ im November 2018 stark gemacht. Unklar blieb, warum nicht eigentlich ihr die Leitung dieses Instituts übertragen wurde. Schließlich leitete sie seit ihrer Berufung im Frühjahr 2017 den organisatorischen Vorläufer dieses Instituts.
An einen Skandal grenzte es freilich, dass bei dem hochoffiziellen Pressetermin die Frage nach der NS-Belastung der documenta-Gründerväter, die spätestens im letzten Jahr bekannt wurde und seitdem kontrovers diskutiert worden war, nicht einmal erwähnt wurde.
Zumal documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann selbst in diversen Statements in den letzten Monaten angedeutet hatte, diese Frage könne Teil der Aufgabe des Instituts sein.
Als Wissenschaftler, der 1986 mit einer Arbeit zur Wirkungsgeschichte der Flakhelfergeneration an der FU Berlin habilitiert worden war, dürfte Bude einen Blick für die Verstrickungen dieser Gründergeneration haben. Von denen offensichtlich sogar noch einzelne Vertreter leben.
Unerklärlich deshalb, dass auch Bude die Frage, was die NS-Belastung von Männern wie Werner Haftmann für die Forschungsagenda des Instituts bedeuten könnte, nicht einmal anschnitt. Die Lösung des „Rätsels der Zeitgenossenschaft“ ist Bude vordringlicher. Um diesem Rätsel auf den Grund zu gehen, soll das Institut auch Gegenwartskunst präsentieren.
Mit „Herkulesaufgabe“ (Kassels Universitätspräsident Reiner Finkeldey) ist Budes künftige Arbeit also nicht nur von diesem neuralgischen Punkt her zutreffend beschrieben. Dazu kommt die Frage nach der offiziellen Verortung des Instituts. Zunächst soll es zur documenta gGmbh gehören. Irgendwann dann aber zur Universität.
Und in Kassel hat eine neue Bürgerinitiative die Frage neu aufgeworfen, ob tatsächlich an dessen zentralem Karlsplatz das neue Gebäude entstehen soll, dass die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat.
Andere sind der Meinung, das ehemalige Sportartikel-Kaufhaus an Kassels Treppenstraße, kurz vor dem Friedrichsplatz könnte ein Alternativ-Standort sein. Das leerstehende Warenhaus hat Ruangrupa, die neue künstlerische Leitung, kürzlich zum „Hauptquartier“ der von ihr kuratierten „d 15“ erkoren.
In einem frühen Aufsatz hatte der am Beispiel von Hans Ulrich Obrists berühmten Gesprächen mit den verrücktesten Initiativen und Akteuren aus Kunst, Wissenschaft, Mode und Politik den „Kurator als Meta-Künstler“ beschrieben, dem es nicht mehr um die Position des Museums, sondern die „Tätigkeit des Versammelns“ gehe. Als „Allesfresser“ jeden verfügbaren Wissens sei er der „Inszenierer einer heterogenen Welt“.
Fast scheint es, als habe Bude damit seinen neuen Job beschrieben. So wie in er dem neuen documenta-Institut eine explosive Mischung aus (kunst-)historischen, kultur- und standortpolitischen sowie wissenschaftlichen Interessen austarieren soll.
Sollte ihm das gelingen, könnte der „Gründungsdirektor“ nach dessen projektierten zwei, drei Jahren womöglich einer Frau den Weg an die Spitze des Instituts ebnen. Vielleicht sogar einer außerhalb von Europa. So viel Liebe zur Weltkunst sollte die documenta in Kassel – trotz des Streits um den Obelisken von Olu Oguibe – doch langsam entwickelt haben.