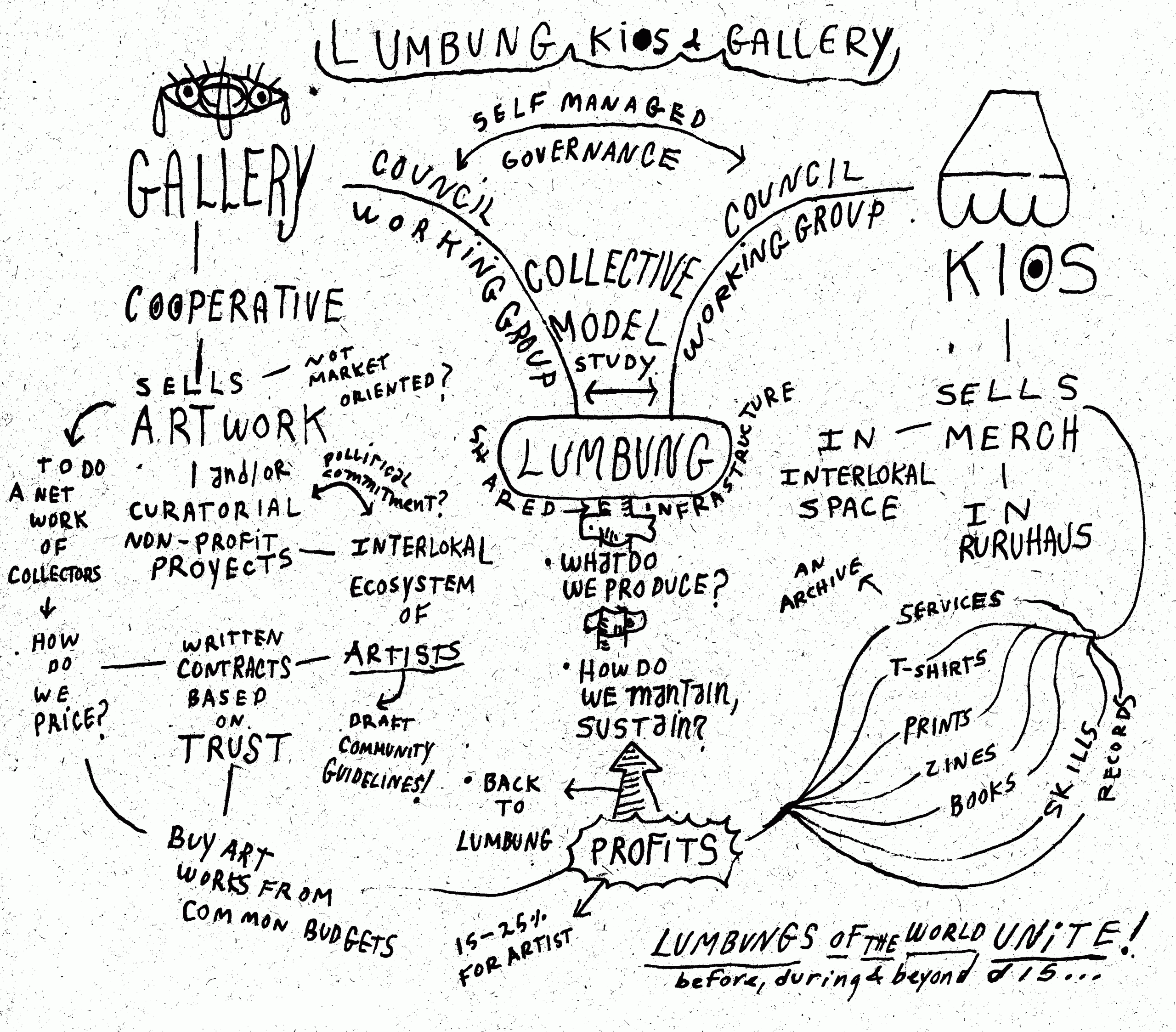
„Everything is for Sale“ steht auf dem handgemalten Schild im Kirchgarten von St. Kunigundis im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. So begeistert die Besucher:innen der documenta fifteen von der Voodoo-Kunst in der entweihten Kirche sind, so sehr stutzen sie, wenn sie auf den kleinen Stand dahinter stoßen.
An einem Holzgerüst können sie Kunst wie auf einem Flohmarkt erstehen: Landschaften, Fabelwesen, Porträts, im handlichen DIN A3-Format, das Stück zu 100 Euro. Einer der haitianischen Künstler gibt den plein-air-Maler an der Staffelei daneben. Aber sind Kunstschauen wie die documenta nicht eigentlich nichtkommerziell?
Der Mythos von der „kommerzfreien Reinheit“ (New York Times) von Biennalen hielt sich lange. Streng genommen war die Geburt der perennierenden Kunstschauen freilich eine aus dem Geist des Marktes.
Als Bürgermeister Riccardo Selvatico 1895 in Venedig die „Mutter der Biennalen“ eröffnete, beschwörte er zwar die „Verbrüderung der Völker“, in erster Linie ging es ihm aber um Standortmarketing.
Die Biennale sollte die schlechte Position der venezianischen Künstler:innen und ihrer Stadt auf dem internationalen Kunstmarkt zwischen London, Paris und Brüssel verbessern. Immerhin 185 von 516 gezeigten Werken wurden auf der ersten Biennale verkauft.
Bei der 60 Jahre später gegründeten Quinquennale namens documenta war es von Anbeginn nicht anders. Auch der Olymp der reinen, unabhängigen, später schwer gesellschaftskritischen Kunst hatte lange eine kommerzielle Ader.
Daran erinnert gerade die Kulturwissenschaftlerin Mela Dávila Freire in ihrer kleinen, aber vorzüglichen Studie („Mission and Commission. Documenta and the Art Market 1955-1968, Polígrafa, Barcelona).
Während der Mitarbeit bei der Schau zur Politischen Geschichte der documenta im Deutschen Historischen Museum (DHM) 2021 stieß die spanische Forscherin auf die Unterlagen zur Geschichte des documenta-Beibootes, mit dem Arnold Bode und seine Mitstreiter ihr prekäres Konstrukt finanziell zu stabilisieren versuchten: die documenta foundation. Dávila Freires Interesse war geweckt, das Büchlein fasst ihre Recherchen zusammen.
Schon 1961 hatte Bode die Idee für eine kommerzielle Sektion der documenta in seinem Plan erwähnt. Gegründet wurde sie drei Jahre später.
Den endgültigen Anstoß für die foundation hatte der unerwartete Erfolg des Verkaufsstandes auf der documenta 2, 1959 gegeben, der den Kölner Galeristen Hein Stünke, wie der documenta-Chefideologe Werner Haftmann ein Mitläufer des NS-Regimes, für seine unentgeltlichen Beraterdienste entschädigen sollte.
Vier Jahre später hatten 25 Künstler, darunter Alexander Calder, George Rickey und Henry Moore für die documenta 3 Arbeiten beigesteuert, von denen die foundation an ihrem Stand im zweiten Stock des Fridericianum auf 100 Exemplare limitierte Editionen verkaufte.
Mit 170.000 Mark Erlös, fand Dávila Freire heraus, trug sie am Ende sogar 70000 Mark mehr zum documenta-Budget bei als das Bundesinnenministerium mit seinem Zuschuss von 100000 Mark.
„Warum sollten wir das bereuen?“ entgegnete Arnold einem Reporter damals kurz und knapp auf die Frage, ob er es gut fände, dass auch die documenta nun ein Kunstmarkt geworden sei.
Die 68’er Revolte beendete das Experiment. Das intransparente Beziehungsgeflecht der foundation geriet unter Kritik: Stünke vermarktete Multiples und Editionen auch in seiner privaten Galerie „Der Spiegel“.
Mit seinem Galeristen-Kollegen Rudolf Zwirner, 1959 documenta-Generalsekretär, hob er 1967 den Kölner Kunstmarkt aus der Taufe. Harald Szeemann und Jean Christoph Amman, die neu berufenen Leiter der documenta 5, ließen die foundation 1971 auslaufen. 1972 gab es keine Edition mehr. Auch die Venedig-Biennale hatte schon 1968 ihre Verkäufe beendet.
Marktfern gibt sich auch die documenta fifteen. Schließlich hat sie bewusst nur eine Handvoll Künstler:innen eingeladen, die von einer renommierten Galerie vertreten werden.
Und mit dem „Seed Money“, einer Art Handgeld für die beteiligten Künstler:innen in Höhe von 10.000 Euro, hat sie erstmals eine Art Basis-Entlohnung eingeführt.
Dass nun ausgerechnet sie, 40 Jahre nach dem Markttabu der 68er dieses Prinzip ganz offen unterläuft, ist nur auf den ersten Blick paradox.
Die „lumbung Gallery“, die ruangrupa für die documenta fifteen gelauncht hat, ist nämlich keine normale Galerie. Vielmehr folgt sie der lumbung-Idee vom nachhaltigen Wirtschaften und Teilen von Ressourcen.
Die für die d15 gelaunchte Plattform soll nicht die Schau finanzieren helfen, wie bei den ersten documentas, sondern die Künstler:innen. Sie erinnert an die Produzentengalerien der 70er Jahre.
Das „Modell einer gemeinsam verwalteten, nicht-spekulativen und regenerativen Galerie“ soll nach dem Willen von ruangrupa auch nach der Schau weiterbestehen.
Um das operative Prinzip der „Lumbung Gallery“ gemeinsam mit der entsprechenden Arbeitsgruppe der documenta zu entwickeln, luden ruangrupa die Initiative „TheArtists“ ein, die unter anderem vom Schweizer Galeristen Beat Raeber und dem Berliner Juristen Martin Heller ins Leben gerufen wurde.
Künstler- und Kurator:innen promoten dort „unbekannte Positionen“ und „diverse Praktiken“ von Künstlern ohne beständige Galerievertretung. Die Erlösverteilung enthält gemeinschaftliche Elemente.
.Normalerweis streichen Galerien 50 Prozent der Verkaufssumme ein, bei „TheArtists“ gehen 65 Prozent direkt an die Künstler, fünf Prozent davon gehen in einen Gemeinschaftstopf. Bei lumbung Gallery gehen 70 Prozent an die Künstler:innen der Werke.
30 Prozent fließen in den lumbung-Topf, über dessen Verwendung am Ende alle an der lumbung Gallery teilnehmenden Künstler und das gesamte lumbung der d15 entscheiden.
Noch steckt das System in den Kinderschuhen. Und nicht alle Werke der 1500 Künstler:innen der documenta fifteen stehen auf der Website der lumbung Gallery.
Preise, wie den des rostigen Wellblech-Eingangs zur documenta-Halle des Wajukuu Art-Projects aus Nigeria müssen Interessenten per Mail erfragen.
Errechnet werden die Preise der lumbung Gallery aus den Produktionskosten und den „basic needs“ der Künstler:innen. Die Bemessungsgrundlage dafür ist der höchste Mindestlohn in einem Land des Globalen Südens. Die Referenz ist Australien mit derzeit 30.000 Euro im Jahr.
Das Interesse an den Werken der d15 ist jedenfalls immens, berichtet Martin Heller: „Inzwischen verkaufen wir täglich Werke“. Für ihn ein Hinweis auf die erstaunliche Diskrepanz zwischen der medialen Wahrnehmung der Schau und der durch die Besucher:innen vor Ort, darunter viele internationale Sammlungen.
Besonders beliebt ist das riesige Ensemble von Gemüse-Plastiken aus Keramik mitsamt dem riesigen Wandgemälde, das das Kochkollektiv Britto Arts Trust aus Bangla Desh in der documenta-Halle aufgebaut hat. Dessen Verkauf steht unmittelbar bevor.
Den Namen des großen europäischen Museums will Heller aber noch nicht nennen. Normale Kunstliebhaber sind bei einzelnen Editions-Stücke wie einem Blumenkohl mit Preisen zwischen 150 und 600 Euro dabei.
Eine Ausnahme vom lumbung-Prinzip sind die Ziegelsteine der indonesischen Jatwangi art Factory, die im Hübnerareal zu einer „Terrakotta-Embassy“ getürmt sind. Kostenpunkt: 400 Euro.
Mit dem Erlös will das Kollektiv in seiner Heimat zwischen zwei Fabriken von Sportartikelherstellern erwerben, um es wieder zu Regenwald aufzuforsten: „Perhutana Family Forest Project“ nennt sich die Initiative.
Auf großes Interesse stoßen die Arbeiten des umstrittenen indonesischen Kollektivs Taring Padi. Der israelische Sammler, ein Kenner indonesischer Geschichte, der dessen Arbeiten erwerben will, zuckte nur mit den Achseln, als Heller ihn auf den Streit um das Banner „People’s Justice“ hinwies. „That’s a german discussion“ überliefert er dessen achselzuckende Reaktion.
Die lumbung gallery scheint jedenfalls einen Nerv getroffen zu haben. Nicht nur, weil sie bereits mehr als 300 Werke verkauft hat. Auch der Widerhall in der Community an einem gemeinwirtschaftlichen Markt ist groß.
Mehrere der in der International Biennial’s Association (IBA) zusammengeschlossenen Organisationen haben die Macher der lumbung Gallery zu Learning sessions eingeladen.
Bei seinen Diskussionen mit den Künstlern, die er alle einzelnen mühsam gewinnen muss, ihre Arbeiten in der lumbung Gallery zu platzieren, will Heller ein starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft bemerkt haben: „Die wollen Teil von etwas sein“. Das gelte auch für viele Sammler, die nicht nur Objekte ansammeln wollen.
Auch Künstler mit eigener Galerie, die auf der documenta vertreten sind, entschließen sich nach Angaben von Heller mehr und mehr, einen Teil ihrer Verkaufs-Erlöse in den Lumbung-Topf zu überführen.
Sollte das System weiterbestehen, wäre das nicht weniger als eine Revolution. Womöglich ein erster Schritt auf dem Weg zur „Kunst als Commons“, einer Diskussion um Gemeingüter, die im Kunstbetrieb gerade schwer Konjunktur hat.
Galerien wären in diesem System überflüssig. Schon bei den ersten documenta-Schauen protestierten diese gegen die privilegierten Verkaufsstände von Stünke&Co. Der Bundesverband Deutscher Galerien (BVDG) dagegen bleibt heute gelassen.
„Es ist es denkbar, dass „sich solche Systeme in bestimmten Gesellschaften etablieren und neben dem herkömmlichen Kunstmarkt Bestand haben könnten; vergleichbar mit den „Fair-Trade“-Projekten“ ließ Geschäftsführerin Birgit Maria Sturm ganz sachlich wissen.
Die Kunsthistorikerin ärgert sich nur, dass ruangrupa mit der Zeichnung, die der Künstler Dan Perjovschi für die lumbung Gallery geschaffen hat, mit Stereotypen arbeite.
In Handschrift steht hier über „Regular Gallery“ eine Sprechblase mit „how much?“, über der „lumbung Gallery“-Sprechblase steht „how, why, who?“. Sturm hält das für „Schwarzweiß-Denken“.
Spannend wird es, wenn Aufmerksamkeitsmaschine documenta im September endet. Ob die lumbung Gallery dann weiterbestehen kann, wird sich zeigen. Heller arbeitet bereits an einer Stiftung, die übernehmen soll, wenn die Anschubfinanzierung durch die documenta endet.
Gespannt beobachtet jedenfalls Mela Dávila Freire, die Chronistin der gescheiterten documenta-Marktversuche der ersten Stunde, den Versuch, den Markt mit einer Kooperative auszuhebeln. „Der Versuch ist unglaublich wichtig“ sagt sie.
